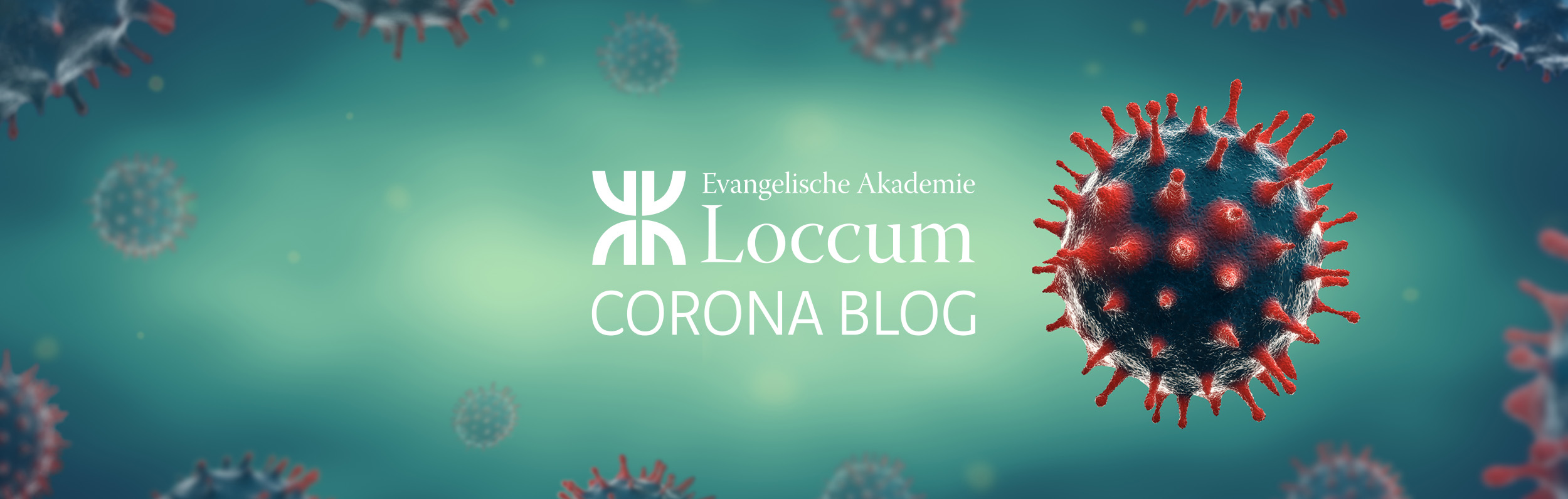
Im Mai hätte in Loccum eine Tagung mit dem Titel „Wendebilder – Deutsche Einheit und Deutsche Teilung in fiktionalen Fernsehformaten“ auf dem Programm gestanden. Tagungen durchführen – das können wir zur Zeit nur unter besonderen Bedingungen mit sehr eingeschränktem Teilnehmendenkreis. Aber lesen – das geht immer! Und da traf es sich gut, dass auf dem literarischen Parkett fast zeitgleich mit dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland drei Neuerscheinungen für Beachtung sorgten. Es erschienen Moritz von Uslars „Nochmal Deutschboden“, Ingo Schulzes „Die rechtschaffenden Mörder“ und Lutz Seilers „Stern 111“, der Roman, der dann auch mit dem Preis der Leipziger Buchmesse (die schon dem Lockdown zum Opfer fiel) ausgezeichnet wurde. Nun gut, dann also Romane (oder besser zwei Romane und ein literarischer Sachtext) – aber ich würde meinen Mund-Nasen-Schutz verwetten, dass sie alle drei, wenn es wieder möglich ist, auch verfilmt werden. Jedenfalls wären Verfilmungen von vorherigen Werken dieser drei Autoren, nämlich von Uslars „Deutschboden“ (R: André Schäfer), Schulzes „Adam und Evelyn“ (R: Andreas Goldenstein) und Seilers „Kruso“ (R: Thomas Stuber) auf der Tagung sicherlich zur Sprache gekommen.
Die Leitfragen der Tagung wären gewesen, welche Bilder von Deutscher Teilung, Wendezeit und Deutscher Einheit sich gesellschaftlich verfestigen, wie diese Bilder über populäre, fiktionale Formate gestaltetet und transportiert werden, und was Erzählen in den Medien zur gesellschaftlichen Erinnerung beiträgt.
Filme, vor allem Fernsehfilme, erreichen ein Millionenpublikum. Das ist bei Literatur nicht der Fall. Und dennoch, das zeigen gerade diese drei Autoren, liefern die literarischen Vorlagen in vielen Fällen nach wie vor die Stoffe für Verfilmungen. Gerade den drei genannten Autoren kann man, wie sie in der Vergangenheit bewiesen haben, ein seismographisches Gespür für gesellschaftliche Stimmungen zusprechen. Moritz von Uslar, der in Berlin lebende Zeit-Journalist, begibt sich für „Deutschboden“ 2009 als teilnehmender Beobachter in die Kleinstadt Zehdenick nördlich von Berlin. Er mietet sich in einem Hotel ein, besucht die Kneipen der Stadt, lernt die Bewohner kennen, findet manches skurril und befremdlich, manches auch sympathisch, aber er beobachtet und beschreibt was er sieht. Und er versteht sicherlich nicht alles, aber entwickelt ein Verständnis für das Leben, das er vorfindet. Die Stärke von Deutschboden war es, dass der Autor nicht moralisierend und von oben herab, sondern mit einer fast kindlichen Neugier und Lust am Entdecken aus der brandenburgischen Provinz schreibt. Das Vertrauen, das er dadurch aufgebaut hat, ermöglicht ihm, 2019, kurz vor den Europa-Wahlen, für „Nochmal Deutschboden“ nach Zehdenick zurückzukehren (ein Highlight des Buches: von Uslar organisiert selbst ein Wahlkampf-Treffen der Bewohner mit der SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley). Diesmal ist er – nach Buch und Film – dort allerdings bekannt wie ein bunter Hund. Trotzdem stellt er Veränderungen fest – die gesunkene Arbeitslosigkeit, die gesetztere und alles in allem zufriedene Lebensführung seiner Protagonisten – und trifft bei der Suche auf Antworten nach der Frage, warum die Rechtspopulisten im Osten Deutschlands so einen großen Zulauf haben auf eine ihm bisher unbekannte Ost-Identität, die entgegen landläufiger Erklärungsmuster nichts mit DDR-Nostalgie und wenig mit Wende-Verlierertum zu tun hat. Eine schlüssige Antwort auf seine Frage findet er hingegen nicht.
Auch Ingo Schulzes Roman knüpft auf stofflicher Ebene an die Frage nach Rechtspopulismus, ja Rechtsradikalismus im Osten Deutschlands an. Der Roman beschreibt die Entwicklung eines leidenschaftlichen Dresdener Antiquars, dem sowohl die allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachwendezeit, als auch speziell der fundamentale Wandel des Buchmarktes, etwa durch die Digitalisierung, zu schaffen machen, und ihn zu einem zuerst politisch rechtslastigen eigenwilligen Kautz und dann zu einem rechtsradikalen Täter werden lassen. Was zunächst auf der Ebene des Plots eindeutig wirkt (Wendeverlierer radikalisiert sich), wird auf literarischer Ebene vertrackt: Der Erzähler der eigentlichen Geschichte wird in einem zweiten Teil selbst zum Protagonisten – zum einstigen Bewunderer des Antiquars und zum Lebenspartner der Antiquars-Gehilfin, die, wie in einem kurzen dritten Teil des Roman nunmehr von der Herausgeberin des Buchs beschrieben, eigentlich (auch?) mit dem Antiquar verbandelt war, eine Tatsache, die der Autor unterschlägt und die ihn somit ganz und gar unzuverlässig macht. Am Ende sind jedenfalls beide, Antiquar und Frau, tot. Was aber Zufall, was Mord, was Rufmord, was Fiktion und was Wirklichkeit ist, bleibt unklar.
Carl, der Protagonist von Lutz Seilers „Stern 111“ wird im Wendeherbst von der Ankündigung seiner Eltern überrascht, sie wollten in den Westen übersiedeln und dort ein neues Leben beginnen. Einstweilen solle er die Wohnung in der thüringischen Provinz hüten. Dieser Aufgabe entzieht er sich mit schlechtem Gewissen, begibt sich nach Ost-Berlin und schließt sich einer Gruppe von Hausbesetzern im Prenzlauer Berg an, mit denen er eine Kneipe gründet. Der Roman lebt von den genauen, autobiographisch geprägten Beschreibungen eines bestimmten Milieus in der Wendezeit, die einerseits sehr realistisch sind, andererseits sehr kunstvoll eine mystisch-magische Welt entstehen lassen. Er besticht aber auch als ein Text, der in herausragender Weise das Verhältnis zwischen Eltern und Sohn thematisiert. Zunächst ist da der Abnabelungsprozess, der Carl immer wieder ein schlechtes Gewissen bereitet, da er seine Eltern im Unklaren darüber lässt, dass er in Wahrheit gar nicht im heimischen Thüringen, sondern in Berlin ist. Dann aber wird klar, dass die Eltern nun einfach die Zeit als für gekommen sehen, ihren Traum zu verwirklichen, und die Gelegenheit, dass die Grenzen offen und der Sohn groß genug ist, beim Schopf packen. Diese letztlich nicht nur für den Sohn, sondern vor allem auch für die Eltern emanzipatorische Situation kann als Parabel auf die gesamtgesellschaftliche Situation zur Wendezeit gelesen werden.
So unterschiedlich die Texte sind – ihnen ist gemeinsam, dass sie die Komplexität und Uneindeutigkeit der Wende- und Nachwendezeit herausarbeiten und damit landläufige und klischeehafte Annahmen über „die Verhältnisse“ im Osten dekonstruieren. Darin besteht ihre große literarische Qualität.
(Lesen Sie in der nächsten Woche den zweiten Teil der Corona-Lektüren von Albert Drews)
Corona-Lektüreliste:
Moritz von Uslar: Nochmal Deutschboden. Meine Rückkehr in die brandenburgische Provinz. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2020.
Ingo Schulze: Die rechtschaffenden Mörder. Frankfurt a. M., S. Fischer 2020.
Lutz Seiler: Stern 111. Berlin: Suhrkamp 2020.
In unserem Corona Blog schildern Studienleiter*innen der Akademie und der Akademie als Referent*innen verbundene Persönlichkeiten ihre Wahrnehmungen zur Coronakrise. Aus den verschiedenen interdisziplinären Arbeitsbereichen entsteht damit eine multiperspektivische Sicht, die in der Krise Orientierung bieten kann. Gleichzeitig wird deutlich, wie die Akademie ihre Arbeit auf diese Ausnahmesituation anpasst.




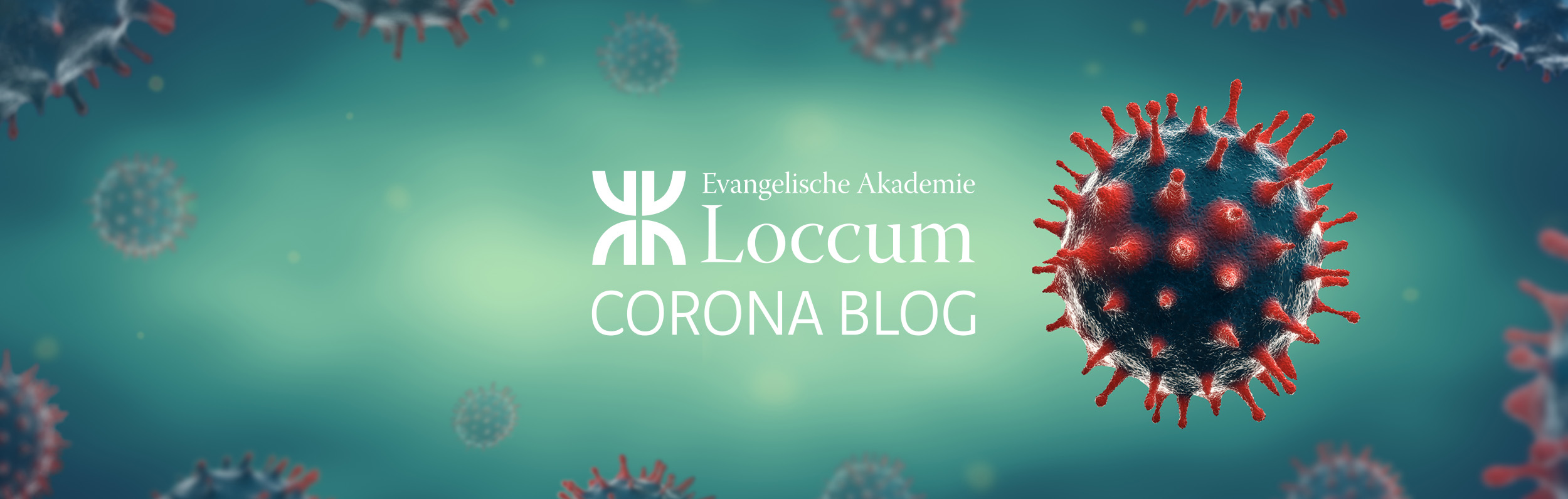

Neueste Kommentare