
„…auf dass wir alle eins seien“


Joachim Lange und Josef Hilbert (Hrsg.): Gesundheitsversorgung in ländlichen Räumen. Nachhaltigkeit für erfolgreiche Pilotprojekte und Regionen, Loccumer Protokolle Band 67/2020, Rehburg-Loccum 2021, ISBN 978-3-8172-6720-0, 150 Seiten
Inhalt
Joachim Lange und Josef Hilbert
Vorwort
Josef Hilbert und Petra Rambow-Bertram
Sorgen machen ist wichtig, gute Lösungen finden und breit nutzbar machen wichtiger! Einleitung in Hintergründe und Ziele der Fachtagung
Carola Reimann
Probleme erkennen, Akteur*innen stärken, Potentiale entfalten! Handlungsmöglichkeiten auf Länderebene
Christoph Löschmann, Markus Müller, Madeleine Renyi
Elektronische Patientenakte sichert integriertes Behandlungsmanagement. Erste Erfahrungen aus dem Kinzigtal mit der Vernetzungssoftware elpax
Corinna Morys-Wortmann
Hebammen- und Schwangeren-Versorgung digital unterstützt und koordiniert. Das Projekt HEDI
Sabine Mertsch
Digitalisierung im Gesundheitswesen: Eine Chance fürs ganze Land. Digitale Services bieten zahlreiche Vorteile für die Gesundheitsversorgung und fördern die Versorgungssicherheit – auch in ländlichen Regionen am Beispiel der außerklinischen Beatmung
Beate Lubbe
Hausarzt im ländlichen Raum: eine bedrohte Art?
Nils Schneider, Isabel Kitte, Rolf Stegemann, Kambiz Afshar
„Landpartie“ in der Ausbildung von Medizinstudenten
Olaf Elsner
Apotheke 2.0: eine Perspektive der pharmazeutischen Versorgung
Birgit Fischer und Josef Hilbert
Welche Rolle werden Krankenhäuser für zukunftsfähige ländliche Versorgungslandschaften spielen? Thesenartig zusammengefasste Eindrücke aus einer virtuellen Podiumsdiskussion
Philipp Potratz und Daisy Hünefeld
Strategie und Perspektiven der regionalen Verbundentwicklung
Helmut Hildebrandt
Versorgung neu und integriert denken – regional, verantwortlich, zukunftsorientiert. Das Konzept „Innovative Gesundheitsregionen“
Mark Barjenbruch
Gestaltungs- und Finanzierungsperspektiven für mehr Gesundheit auf dem Lande
Armin Lang
Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen. Mehr Nachhaltigkeit für erfolgreiche Pilotprojekte und Regionen
Uwe Borchers, Josef Hilbert und Helmut Hildebrandt
Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen: Stärkt die Regionen bei der Gestaltung unserer Zukunft! Zusammenfassung der Ergebnisse der mehrteiligen Veranstaltungsreihe aus der Perspektive des NDGR

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine markiere eine „Zeitenwende“ – so Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am 27. Februar. Seitdem werden wir täglich überrascht von neuen politischen Wendungen: Scholz bewilligte im Handumdrehen 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Nachrüstung der Bundeswehr. Die Bundesrepublik liefert militärische Abwehrwaffen in ein Kriegsgebiet. Die Grüne Außenministerin Baerbock kündigt eine Nationale Sicherheitsstrategie an – unsere Sicherheit wird nun nicht mehr nur am Hindukusch, sondern in der gesamten vernetzten Welt verteidigt. Die EU will bis 2025 eine gemeinsame Eingreiftruppe von rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten aufstellen – und Deutschland wird als erstes Land die Führung übernehmen.
Eine „Zeitenwende“ deutscher Politik ist dies jedoch nicht: Die begann bereits mit der deutschen Beteiligung an den Luftangriffen der NATO im Kosovo-Krieg 1999 – ein Kampfeinsatz, für den es nicht einmal ein UN-Mandat gab. Damals war Joschka Fischer (Grüner!) Außenminister. Es war der erste Kampfeinsatz deutscher Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Einsätze kamen hinzu: So folgte Deutschland den USA in den Einsatz nach Afghanistan. Mit rund 3.000 Soldatinnen und Soldaten ist die Bundeswehr derzeit auf drei Kontinenten an elf Einsätzen beteiligt: Als Teil der KFOR-Truppen im Kosovo, in Jordanien und dem Irak im Kampf gegen den „Islamischen Staat“, als Teil der NATO-Sicherheitsoperation „Sea Guardian“ im Mittelmeer, im Rahmen der „European Union Training Mission“ in Mali, mit der UN im Libanon, mit der EU am Horn von Afrika, bei UN-Missionen im Südsudan und in der Westsahara. Die Militärausgaben sind zwischen 2005 und 2020 kontinuierlich angestiegen: von 33,3 Milliarden US-Dollar 2005 auf 52,8 Milliarden US-Dollar 2020. Das Volumen der Rüstungsexporte stieg gar von gut fünf Milliarden Euro im Jahr 2009 auf 9,35 Milliarden Euro im Jahr 2021. Anstatt einer „Zeitenwende“ sehe ich eher eine sich verstetigende Kontinuität in Deutschlands Unterstützung der Rüstungsindustrie. Und ein deutlicheres Bekenntnis zu militärischen Einsätzen.
In unserer Tagungsreihe „Friedenseinsätze…“ werden militärische Interventionen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte kritisch hinterfragt: Was wurde daraus gelernt – und was nicht? Die bittere Wahrheit ist: Keiner der oben erwähnten Einsätze der Bundeswehr hat bisher zu einem dauerhaften Frieden in einer Weltregion geführt. Der Rückzug aus Afghanistan, der für die einheimische Bevölkerung katastrophale Folgen nach sich zieht, bildet nur die Spitze des Eisbergs aus bleibendem Unfrieden.
„Aus Gottes Frieden leben – Für gerechten Frieden sorgen“, so lautet der Titel der EKD-Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007. Sie verwirft Friedenssicherung durch nukleare Abschreckung und gibt der zivilen Konfliktbearbeitung eindeutig Vorrang vor militärischen Interventionen. Sie fordert präventives Handeln für die Förderung eines nachhaltigen Friedens und die Stärkung ziviler Friedens- und Entwicklungsdienste. Damit sollte eine „Zeitenwende“ eingeleitet werden, in der Krieg keine Option mehr ist.
Ist diese Friedensethik nun am russischen Angriff auf die Ukraine gescheitert?! Waren die politischen Bemühungen um Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, das jahrzehntelange ökumenische Engagement für eine Transformation christlicher Ethik – weg von der Rechtfertigung für einen „gerechten Krieg“ und hin zum Einsatz für einen „gerechten Frieden“ – denn vergeblich?!
Ich glaube nicht. Der russische Angriffskrieg ist völkerrechtswidrig und durch nichts zu rechtfertigen. Dennoch müssen meines Erachtens die fortgesetzte – neue! – Blockbildung und die ebenfalls fortgesetzten Investitionen in Kriegsmaschinerie kritisch hinterfragt werden. Den deutschen Militärausgaben in Höhe von fast 53 Milliarden US-Dollar steht dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ein Etat von gerade einmal 12 Milliarden Euro gegenüber. Präventive Arbeit für einen gerechten Frieden auch finanziell deutlich stärken, die Erkenntnisse aus der Entwicklungszusammenarbeit in UN-Friedenseinsätze übertragen, energiewirtschaftliche Abhängigkeiten von autoritären Staaten entschieden beenden und damit den Oligarchien die Machtbasis entziehen – das wäre eine „Zeitenwende“, die den Namen verdient! Dafür sollten sich auch die Kirchen mit ihrer wirtschaftlichen Kraft einhellig einsetzen und so ihre Friedensethik mit kräftigen Taten unterstützen. Die evangelischen Positionen zur Friedens- und Sicherheitspolitik werden übrigens in einer Expertinnen- und Expertentagung vom 1. bis 2. April 2022 an der Evangelischen Akademie Loccum diskutiert.
In der Kolumne „Hinterfragt“ veröffentlicht Akademiedirektorin PD Dr. Verena Grüter ihre persönliche Sicht der Dinge.



Dr. Ralph Charbonnier, Theologischer Vizepräsident des Ev.-luth. Landeskirchenamtes Hannover, führte heute Abend Dr. habil. Jordanka Telbizova-Sack in ihr Amt als Studienleiterin der Evangelischen Akademie Loccum ein. Die Einführung fand im Rahmen der traditionellen Hora in der Stiftskirche Loccum statt.
Frau Telbizova-Sack verantwortet als Studienleiterin den Arbeitsbereich Religion und Politik in der Migrationsgesellschaft und ist in dieser Position bereits seit September 2019 in Loccum tätig. Sie ist Sozial- und Religionswissenschaftlerin, stammt aus Bulgarien, promovierte im Fachbereich Sozialwissenschaften an der Universität Göttingen und habilitierte 2015 im Fach „Religionswissenschaft mit Schwerpunkt Islam/Europa“ an der Universität Erfurt.
Jordanka Telbizova-Sack arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Humboldt-Universität zu Berlin, am Osteuropa-Institut der FU Berlin sowie an den Universitäten Göttingen und Erfurt. 2016 hatte sie eine Gastprofessur an der Universität Wien inne.
Zu ihrer Arbeit in Loccum sagte Frau Telbizova-Sack: „Ich möchte wichtige gesellschaftliche Diskurse in meinem Arbeitsbereich vorantreiben, in strittigen Fragen vermitteln, das Profil der Akademie stärken und zur verantwortlichen Planung zukünftiger Entwicklungen in der Gesellschaft beitragen.“
Loccum, 13. Mai 2021
Monika C. M. Müller (Hrsg.): Landwirtschaft für Biodiversität. Artenvielfalt zwischen Wissenschaft und landwirtschaftlicher Praxis, Loccumer Protokolle Band 64/2021, Rehburg-Loccum 2022, ISBN 978-3-8172-6421-6, 198 Seiten
Inhalt
Monika C.M. Müller
Vorwort
Lukas Wortmann
Das WWF-Projekt Landwirtschaft für Artenvielfalt. Gemeinsam mit den Landwirt*innen die Biodiversität erhalten
Hans-Albrecht Witte
Landwirtschaft für Artenvielfalt. Landwirtschaftlicher Projektteilnehmer
Leen Vellenga et al.
FINKA – ein Projekt zur Förderung von Insekten im Ackerbau
Heinrich Kersten
Blühstreifen: Was bringen sie langfristig für die Biodiversität? Blühstreifen und Mischungen
Werner von der Ohe
Blühflächen zur Verbesserung des Nahrungsangebotes für Honig- und Wildbienen
Greta Gaudig
Biodiversität schützen und nachhaltig wirtschaften in Mooren?
Hans Lütjen Wellner
Landwirtschaft im Teufelsmoor
Lukas Beule
Der Mehrwert von Agroforst für die Biodiversität
Christian Warnke
Der Mehrwert von Agroforst für die Biodiversität – Ein Anfang aus der Praxis
Daniel Hering et al.
Insektenschutz durch Gewässerrandstreifen. Eine Studie im Auftrag des NABU (Naturschutzbund Deutschland) e. V.
Georg Meiners
Biotopverbund – Herausforderungen für Landwirte
Michael Trepel
Empfehlungen der Allianz für Gewässerschutz in Schleswig-Holstein für die Einrichtung von Gewässerrandstreifen
Alexander Kasten
Projekt Eigene Vielfalt: Gemeinsam zum Biotopverbund mit Naturschutz und Landwirtschaft
Hanna Meyer
Was sagen junge Menschen zur Zukunft von Naturschutz und Landwirtschaft?
Jens Dauber
Der Niedersächsische Weg: nur Weg oder auch Ziel?
Carolin Grieshop
Ein Jahr „Niedersächsischer Weg“. Was lief gut? Wo muss nun eine Umsetzung eingeleitet werden? Stimmen Richtung und Tempo
Holger Hennies
Ein Jahr „Niedersächsischer Weg“
Ludwig Theuvsen
Der „Niedersächsische Weg“: Miteinander für mehr Biodiversität

Eine Meldung des Dachverbandes der Evangelischen Akademien in Deutschland anlässlich des 9. Novembers:
Am 9. November jährten sich die Novemberpogrome des Jahres 1938 zum 85. Mal. Gemeinsam mit Johanna Stoll von der Jüdischen Gemeinde zu Dresden und Dr. Sebastian Meyer-Stork von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dresden gedachten Vertreter*innen der Evangelischen Akademien der Opfer in Dresden. Sie besuchten zunächst die „gläserne Bank“ und legten um 18 Uhr Blumen an der Gedenkstele am Hasenberg nieder. Die Stele erinnert an die Alte Synagoge der Jüdischen Gemeinde, die von den Nationalsozialisten zerstört wurde. Pfarrer Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing und Vorsitzender der Evangelischen Akademien in Deutschland, sagte: „Das Gedenken an die Pogrome der NS-Diktatur ist für uns eine bleibende Mahnung und Verpflichtung. Gerade jetzt, da die Hamas in Israel Menschen ermordet und antisemitische Gewalt in unserem Land zunimmt, müssen wir ohne Wenn und Aber an der Seite von Jüdinnen und Juden stehen. ‚Nie wieder‘ darf keine leere Phrase sein.“
Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen, erklärte: „Mit dem 9. November 1938 wird daran erinnert, welches Leid Deutsche über Jüdinnen und Juden gebracht haben. Synagogen und Häuser brannten, millionenfacher Mord folgte. Ein Zivilisationsbruch, dem systematischer Entzug von religiösen und staatsbürgerlichen Rechten vorausging. Beschämende Verbrechen. Der Ruf aus den Kirchen und der Gesellschaft sollte lauten: Diese Schuld darf nicht vergessen werden; jedem antisemitischen Hass treten wir entgegen.“
Während der Novemberpogrome 1938 wurden jüdische Einrichtungen, Geschäfte und Synagogen im gesamten Deutschen Reich koordiniert angegriffen, geplündert und gebrandschatzt. Jüdische Menschen waren über mehrere Tage Gewalt und exzessivem Terror ausgesetzt.
Die Dresdner Synagoge wurde niedergebrannt und die Überreste einige Tage später gesprengt. Heute erinnert eine Stele an das Gotteshaus. Sie trägt folgende Inschrift: Hier stand die 1838–1840 von Gottfried Semper erbaute, durch Oberrabbiner Dr. Zacharias Frankel geweihte und am 9. November 1938 von den Faschisten zerstörte Synagoge der Israelitischen Religionsgemeinde zu Dresden. Gegenüber steht die neue Synagoge, die Ende der 1990er-Jahre erbaut wurde. Heute gibt es drei jüdische Gemeinden in Dresden mit über 700 Mitgliedern. Die jüngste haben liberale Jüdinnen und Juden im Jahr 2021 gegründet. Sie sieht sich auch als Ansprechpartnerin für jüdische Menschen, die einen nicht-religiösen Zugang zu ihrem Judentum suchen.
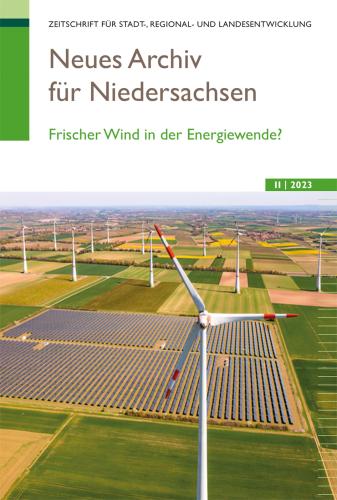
Frischer Wind in der Energiewende?
Neues Archiv für Niedersachsen 2 / 2023
Open Access pdf:
https://www.wachholtz-verlag.de/out/media/240318_6479-4_Inhalt_NieSa_2_23_final(2).pdf
Der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft sind wesentliche Voraussetzungen für die Erreichung der Klimaziele. Darüber hinaus bietet ihr Ausbau erhebliche Potenziale für die Regionalentwicklung, deren Realisierung an zahlreiche Voraussetzungen gebunden ist. Mit dem Blick auf den Artenschutz, das Landschaftsbild und Immissionen wurden bislang erhebliche Bedenken geltend gemacht, die zu langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren führten. Der Bundesgesetzgeber hat vielfältige Initiativen und Diskussionen angestoßen, wie die Potenziale der Erneuerbaren Energien genutzt und zugleich die Anliegen des Arten- und Landschaftsschutzes berücksichtigt werden können. Das Heft „Neuer Wind in der Energiewende?“ dokumentiert in seinem Schwerpunkt maßgeblich ausgewählte Beiträge einer gleichnamigen Tagung in der Evangelischen Akademie Loccum im März 2023.
Inhalt
Editorial
Schwerpunkt
– Hanno Kempermann: Auswirkungen des beschleunigten Ausbaus der Erneuerbaren und der Wasserstoffwirtschaft auf den Strukturwandel in Deutschland
– Arno Brandt, Ulrich Scheele: Industriepolitische Herausforderungen der Energiewirtschaft in der Zeitenwende
– Felix Fleckenstein: Politische Überlegungen zu Energiewende, Wertschöpfung und Beschäftigung
– Erneuerbare Energien: Volle Wertschöpfung im Norden. Interview mit Stephan Frense, CEO der Erneuerbaren-Gruppe ARGE Netz, Husum
– Stephan Löb: Flächeninanspruchnahme durch die Energiewende in Niedersachsen
– Wolfgang Jung, Axel Priebs: Flächensicherung für die Windenergie
– Magnus Buhlert: Ausweisung von Windflächen und Akzeptanzsteigerung für Erneuerbare Energien in Niedersachsen
– Steven Salecki: Bürgerbeteiligung und regionale Wertschöpfung als Faktoren für die lokale Akzeptanz erneuerbarer Energien
– Holger Schmitz, Jenny Witzel: Planen und Genehmigen von Windenergieanlagen
– Catrin Schmidt: Planungs- und Genehmigungsverfahren im Spannungsfeld zwischen Erneuerbaren Energien und Natur- und Landschaftsschutz
Außerhalb des Schwerpunktes
– Roland Czada: Genossenschaftstheorie, Verhandlungsdemokratie und deutscher Sonderweg
Pro und Contra
Beim Aufbau eigener Solarproduktionskapazitäten sollte sich das Land Niedersachsen als Minderheitsgesellschafter unternehmerisch engagieren
– Arno Brandt: Pro
– Reinhold Hilbers: Contra
Aus Wissenschaft und Forschung
– Mit dem ALR-Hochschulpreis ausgezeichnete Arbeiten
– Johanna Eggers: Wird das Wasser knapp in Niedersachsen?
– Anika Henning, Leon Thümer: Flächensparen in der kommunalen Praxis – zwischen Notwendigkeit und Wirklichkeit
– Toya Engel: Soziale Innovationen in Transformationsprozessen
Rezensionen
– Axel Freiherr von Campenhausen (2022): Für Kirche, Staat und Gesellschaft. Erinnerungen (Rezensent: Hansjörg Küster)
– David Vollmuth (2021): Die Nachhaltigkeit und der Mittelwald. Eine interdisziplinäre vegetationskundlich-forsthistorische Analyse oder: Die pflanzensoziologisch-naturschutzfachlichen Folgen von Mythen, Macht und Diffamierungen (Rezensent: Hansjörg Küster)
Die aktuelle Karte
– Hans-Ulrich Jung: Niedersachsen – Land der erneuerbaren Energien
– Autorenverzeichnis
– Redaktion
– Impressum
Die Reihe »Neues Archiv für Niedersachsen«, herausgegeben von der Wissenschaftlichen Gesellschaftzum Studium Niedersachsen e. V., erscheint zweimal jährlich mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zur Stadt-, Regional- und Landesentwicklung.
Christina Schachtner und Albert Drews (Hrsg.): Erzählte Welt. Sinnstiftung in Zeiten kultureller und politischer Umbrüche, Loccumer Kleine Reihe Band 9, Rehburg-Loccum 2021, ISBN: 978-3-8172-2618-4, 246 Seiten
Inhalt
Christina Schachtner
Einleitung
Vera Nünning
Die Relevanz der Erzählforschung als interdisziplinär anschlussfähiges kulturwissenschaftliches Paradigma
Alexandra Strohmaier
Narration als Praxis und Performanz. Zur Revision eines literarischen Kommunikationsmodells
Christina Schachtner
Netzakteur*innen erzählen. Narrative Praktiken im Zeichen digitaler Medien und gesellschaftlich-kulturellen Wandels
Fritz Böhle
Erzählen am Arbeitsplatz – nicht nur Klatsch und Tratsch. Eine arbeitssoziologische Betrachtung
Katrin Rohnstock und Kollektiv
Kollektives Erzählen im Erzählsalon. Eine Veranstaltungsform für Dialog und Raumentwicklung von unten
Marc Ries
Microstorias? Anmerkungen zu den stories auf Instagram
Wolfgang Kraus
Das Patchwork erzählen. Narrative Identität und Small Stories
Jarmila Mildorf
Durch Andere sich selbst erzählen. Figuren der Selbststilisierung in autobiografischen Schriften von Alan Bennett und Candia McWilliam
Ramón Reichert
„White Dreadlocks“: Hair Politics on YouTube
Wolfgang Müller-Funk
Das Risiko erzählen. Anmerkungen zu einer ungleichen Beziehung
Albert Drews
Erzählforschung als Mehrwert für die gesellschaftspolitische Akademiearbeit. Nachwort
Neueste Kommentare