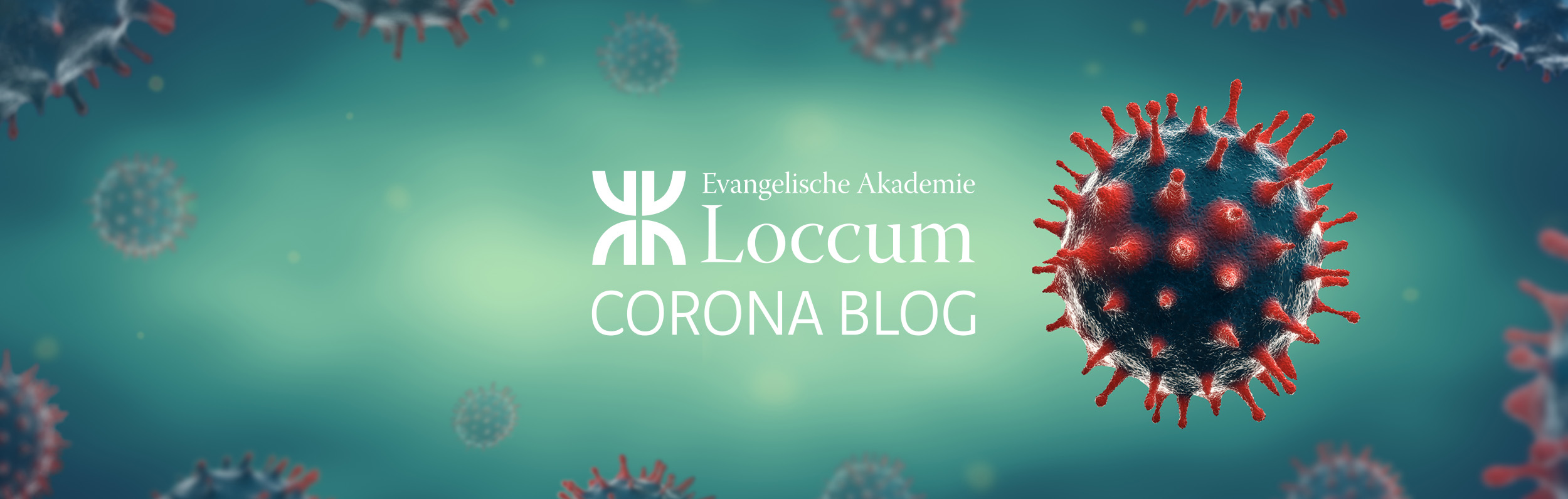
Damit das von vorne herein klar ist: Das neuartige Coronavirus ist keine Biowaffe. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Natürlich sind das Netz und die Sozialen Medien voll von Behauptungen, die das Gegenteil glauben machen wollen. Aber das sind Auswüchse der derzeit grassierenden Flut an Verschwörungstheorien und Desinformationskampagnen.
Warum macht es dennoch Sinn, angesichts der Corona-Krise über Biowaffen nachzudenken? Zwischen Biowaffen und COVID-19 gibt es bei allen Unterschieden doch in puncto Auswirkung und mit Blick auf das Repertoire an Gegenmaßnahmen eine Reihe von Parallelen. Vor diesem Hintergrund lassen sich aus den internationalen Bemühungen zur Prohibition von Biowaffen einige Anregungen ableiten, die eventuell zum wirkungsvolleren Management der derzeitigen Corona-Krise – und möglicher folgender Pandemien – beitragen können. Konkret würde dies die unabhängige Untersuchung von Krankheitsausbrüchen, internationale Kooperationen im Gesundheitssektor sowie verstärkte Vertrauensbildung und Transparenz im Bereich der biologischen Sicherheit betreffen.
Was sind Biowaffen?
Zuerst muss aber geklärt werden, was Biowaffen eigentlich sind und welche Rolle sie in der internationalen Sicherheitspolitik und Kriegsführung bisher gespielt haben?
Biologische Waffen sind krankheitserregende Mikroorganismen, Toxine und andere biologische Agenzien, die zu kriegerischen Zwecken verwendet werden. Milzbrand, Rizin, Pest, Pocken, Tularämie oder Botulinustoxin zählen beispielsweise zu den „Klassikern“ der biologischen Kriegsführung. In den Biowaffenprogrammen der Vergangenheit, die weltweit von einer Reihe von Staaten unterhalten wurden, durften diese hochpathogenen Erreger nicht fehlen. Diese waffenfähigen Viren, Bakterien und Toxine haben erhebliche Zerstörungskraft. Oft wird in diesem Zusammenhang eine Studie des wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongress zitiert. Darin wurde ermittelt, dass ein Angriff mit Milzbrand Sporen (auch Anthrax genannt) auf Washington D.C., mittels eines Flugzeugs mit spezieller Sprühvorrichtung zur Ausbringung des Erregers, vermutlich – je nach Witterungsverhältnissen – 1 bis 3 Million Todesopfer zur Folge haben würde. Es ist daher wenig verwunderlich, dass Biowaffen – neben Chemie- und Atomwaffen – zu der klassischen Trias der Massenvernichtungswaffen zählen.
Insgesamt sollen 22 Staaten in der Vergangenheit über offensive Biowaffenprogramme verfügt haben. Die allermeisten wurden allerdings peu a peu eingestellt. Das Biowaffen-Übereinkommen aus dem Jahre 1972 leistete hierbei einen wichtigen Beitrag. Dieser Vertrag, dem mittlerweile 183 Staaten beigetreten sind, hat eine weltweite Verbotsnorm gegen Biowaffen etabliert. Heute soll nur noch Nordkorea über offensive Biowaffenfähigkeiten verfügen. Einige Stimmen weisen zwar darauf hin, dass nicht sicher sei, ob Ägypten, China, Israel, Russland und Syrien tatsächlich ihre ehemaligen Programme vollständig beendet haben. Aufgrund der hohen Geheimhaltung in diesem Bereich, lässt sich hierzu aber keine belastbare Aussage machen.
Bekannt ist aber, dass Terrorgruppen immer wieder großes Interesse an Biowaffen zeigen. Beispielsweise hat die japanische Aum-Sekte, die für den Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn im Jahre 1995 verantwortlich war, anfänglich intensiv mit Milzbrand experimentiert und den Plan verfolgt, diesen Erreger an verschiedenen Stellen in der japanischen Hauptstadt zu versprühen – ein Vorhaben, das zum Glück scheiterte. Auch islamistische Terrorgruppen haben immer wieder Versuche unternommen, Biowaffen zu erwerben und herzustellen – ebenfalls erfolglos.
Darum ist COVID-19 keine Biowaffe
Biologische Kampfstoffe unterscheiden sich voneinander anhand von drei zentralen Kriterien: erstens, ob sie flächig über ein großes Terrain wirken, zweitens, ob es einen Impfstoff gegen sie gibt und, drittens, ob sie von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Jede bekannte Biowaffe verneint zumindest eines dieser Kriterien. Genau darin besteht der entscheidende Unterschied zum Coronavirus, das bekanntermaßen alle drei genannten Merkmale erfüllt (großflächige Wirkung, kein Impfstoff, von Mensch zu Mensch übertragbar), somit für eine militärische Anwendung gänzlich ungeeignet ist und als Biowaffe nicht infrage kommt. Schließlich wären beim Einsatz einer solchen fiktiven Corona-Biowaffe aufgrund der offensichtlichen Gefahr der Selbstansteckung, der schwer kontrollierbaren Ausbreitungswege und des fehlenden Impfstoffs die eigenen Truppen bzw. die eigene Bevölkerung im hohen Maße gefährdet. Kein Militär der Welt und nicht mal die radikalsten Terrorgruppen wären an einer solchen Waffe interessiert.
Trotz aller Unterschiede: Es gibt Parallelen und Gemeinsamkeiten
Dennoch gibt es – trotz aller Unterschiede – in puncto der Auswirkungen und mit Blick auf das Repertoire an Gegenmaßnahmen eine Reihe von Parallelen zwischen COVID-19 und Biowaffen. In beiden Fällen haben wir biologische Erreger mit erheblicher Zerstörungskraft. Auch wenn es Risikogruppen gibt, so gefährden biologische Waffen wie auch das Coronavirus Menschenleben unterschiedslos. Das Virus und Biowaffen verwandeln menschliche Nähe von einem Areal der Geborgenheit zu einer Gefahrenzone. Jenseits der konkreten unmittelbaren Wirkung im Falle einer Infizierung verbreitet COVID-19 wie auch Biowaffen breitflächig Furcht und Bedrohungsängste und wirkt in diesem Sinne terrorisierend auf Gesellschaften. Ferner sind es vor allem Krankenhäuser, Labore, zivile Ersthelfer, und Biowissenschaftler*innen, die in der vordersten Verteidigungslinie stehen – sowohl bei Corona als auch bei Biowaffen.
Vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeiten bieten die weltweiten Bemühungen zum Verbot von Biowaffen mindestens drei Lehren, die für das derzeitige Management der Corona-Krise interessant sein könnten.
Der Mechanismus des UN-Generalsekretärs auch für COVID-19?
Der Vorwurf eines Biowaffeneinsatzes ist schwer aufzuklären. Schließlich ähneln biologische Waffen – wie wir eben gesehen haben – im hohen Maße natürlichen Krankheitsausbrüchen. Zudem sind solche Vorfälle stets ein großes Politikum und die jeweiligen verdächtigten Staaten haben häufig ein großes Interesse, Aufklärung und Transparenz zu verhindern.
Im Fall der Corona-Krise sehen wir vergleichbare Entwicklungen in der Debatte um die Untersuchung des Ausbruchs des Virus im chinesischen Wuhan. Washington und Peking überschütten sich derzeit mit Vorwürfen und es ist fraglich, ob die an sich sehr wichtige Aufklärung der genauen Abläufe in der Frühphase der Pandemie, die vermutlich weiteren Aufschluss über das neuartige Virus liefern könnten, sich vor diesem Hintergrund tatsächlich realisieren lassen.
Angesichts derartiger und vergleichbarer Schwierigkeiten wurde im Bereich der Biowaffen (und ebenfalls der Chemiewaffen) in den 1980er Jahren der sogenannte UN Secretary-General’s Mechanism eingeführt. Dieser erlaubt es dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, eine unabhängige internationale Untersuchung einzuleiten, wenn ein Verdachtsfall eines Biowaffeneinsatzes durch ein UN-Mitgliedstaat gemeldet wird. Dieser Mechanismus wurde in der Vergangenheit in eine Reihe von Fällen aktiviert. Zuletzt 2013 in Syrien – auch wenn dort Chemiewaffen und nicht biologische Kampfmittel im Vordergrund standen.
Der UN-Generalsekretärsmechanismus basiert dabei auf etablierten Regularien und eingespielten Verfahren. So gibt es beispielsweise eine stetig aktualisierte Liste an weltweit verfügbaren Expert*innen (der sog. „roster“), die im Ernstfall schnell aktiviert und in den Einsatz geschickt werden können. Speziell zertifizierte Labore, die Proben nach festen Standards untersuchen und internationale Transparenz herstellen, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ferner fanden – gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Syrien – weltweit verschiedene Trainings statt, die die Leistungsfähigkeit dieses Mechanismus in den letzten Jahren weiter gestärkt haben.
Aufgrund der Parallelen zwischen Biowaffen und dem neuartigen Coronavirus sowie den politischen Blockaden, die mit Blick auf eine Untersuchung der Vorgänge in Wuhan in den letzten Wochen immer deutlicher geworden sind, erscheint es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob der UN-Generalsekretärsmechanismus auf die Aufklärung von Epidemien ausgeweitet werden könnte. Die Entscheidung dazu muss dabei nicht unbedingt vom UN-Sicherheitsrat getroffen werden. Der ursprüngliche Mechanismus geht ebenfalls auf einen Entschluss der UN-Vollversammlung zurück – da in den 1980er Jahren der UN-Sicherheitsrat ähnlich blockiert war, wie heute.
Neben den eingespielten Abläufen, die der Mechanismus mitbringt, hätte er auch einen klaren politischen Mehrwert. Denn wenn sich Großmächte wie die USA und China derart uneinig sind, gibt es weltweit kaum Akteure, die ausreichend Gewicht und die notwendige Überparteilichkeit mitbringen, um zu schlichten und mit der notwendigen Nüchternheit für Aufklärung und Transparenz sorgen können. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wäre vermutlich die Person, die hierfür am ehesten infrage kommen würde – auch wenn diese Aufgabe alles andere als leicht zu schultern wäre.
Das Biowaffenregime als ein Nukleus für eine neue multilaterale Gesundheitspolitik?
Eine zweite Anregung, die sich aus dem weltweiten Verbotsanstrengungen zu Biowaffen für den Umgang mit den Auswirkungen von COVID-19 ableiten lässt, bezieht sich auf internationale Kooperationen zur Eindämmung und Verhinderung von biologischen Gefahren. Neben der Prohibition von biologischen Kampfstoffen kennt das Biowaffen-Übereinkommen auch Normen zur friedlichen Zusammenarbeit in puncto Gesundheitsschutz, Laborsicherheit und biologischer Forschung vor allem zu hochpathogenen Krankheitserregern. Seit 2013 hat das deutsche Biosicherheitsprogramm in diesem Rahmen beispielsweise knapp 50 Millionen Euro in Zusammenarbeit mit Partnerländern vor allem in Afrika, dem Nahen Osten und Zentralasien investiert. Das Robert-Koch-Institut, das derzeit in aller Munde ist, spielte dabei eine zentrale Rolle. Eine ganze Reihe weiterer Staaten unterhalten ähnliche Kooperationen.
Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die weltweite Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich dringend verbessert werden muss. Es bedarf intensivere Abstimmung über Pandemiemaßnahmen, Schutzkonzepte und Forschungsergebnisse – insbesondere, wenn es um derart zentrale Aspekte wie die Entwicklung von Impfstoffen geht. Die Erfahrungen, die mit internationalen Kooperationen im Rahmen des Biowaffen-Übereinkommens vor allem mit Blick auf hochpathogene Erreger gemacht wurden, können in dem nun beginnenden Suchprozess nach einer geeigneten multilateralen Gesundheitsordnung einen wichtigen Impuls geben und für neu zu etablierende internationale Foren eine Art Nukleus bilden.
Stärkeres Biowaffen-Übereinkommen = Besseres Corona-Management
Drittens kann aber auch eine Verbesserung des Biowaffen-Übereinkommens selbst einen Beitrag zum besseren Management der Corona-Krise leisten – und aller weiteren Pandemien, die in der Zukunft eventuell noch kommen könnten. Die Behauptung beim neuartigen Coronavirus handele es sich in Wirklichkeit um eine Biowaffe wurde nämlich nicht nur in der Verschwörungstheorie-Szene ventiliert. Auch Vertreter*innen aus Regierungskreisen in den USA, China, Russland und Iran warfen sich derartige Argumente an den Kopf – vor allem in der Frühphase der Krise. Dass eine derartige Instrumentalisierung der Pandemie überhaupt möglich war, ist auch in der Schwäche des Biowaffen-Übereinkommens begründet und könnte durch eine Stärkung dieses Vertragswerks in der Zukunft behoben werden.
Auch wenn dieses Übereinkommen relativ viele Mitgliedsstaaten hat und offensive Biowaffenprogrammen weltweit fast vollkommen eingestellt wurde, lässt die Leistungsfähigkeit dieses Vertragswerk doch ziemlich zu wünschen übrig. So gibt es beispielsweise kein systematisches Monitoring, ob die vertraglichen Verpflichtungen von den Mitgliedsstaaten überhaupt eingehalten werden. Ein ernst zu nehmendes Verifizierungssystem fehlt im Biowaffen-Übereinkommen. Zudem gibt es keine Vertragsorganisation, die unabhängige Expertise in diesem Politikfeld einbringen und als Anwalt der Verbotsnormen agieren könnte – anders als das beispielsweise mit der IAEO und der OPCW bei den internationalen Verträgen zu Atom- und Chemiewaffen der Fall ist.
Würde das Biowaffen-Übereinkommen gestärkt, wäre das Niveau der Transparenz und des wechselseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten ein deutlich anderes als es heute der Fall ist. Einer Instrumentalisierung von Krankheitsausbrüchen würde somit ein Riegel vorgeschoben. Der Gefahr einer übermäßigen Politisierung von Pandemien – wie wir sie derzeit zwischen den USA und China massiv erleben – würden zumindest gewisse Grenzen gesetzt.
Eine Stärkung des Biowaffen-Übereinkommens schien lange Zeit hoffnungslos. Die Gräben zwischen den verschiedenen Parteien war tief und die zahlreichen internationalen Konferenzen, die in den vergangenen Jahren im Genfer UN-Gebäude dazu abgehalten wurden, brachten keine nennenswerten Fortschritte. 2021 findet das nächste große Staatentreffen im Rahmen des Biowaffen-Übereinkommens statt. Es gilt zu hoffen, dass die globalen Erfahrungen der Corona-Krise weltweit die Perspektiven auf biologische Gefahren ändert und somit diplomatischer Spielraum für Reformen möglich wird. Dann könnte das Biowaffen-Übereinkommen nicht nur Impulse für einen wirkungsvolleren Umgang mit COVID-19 liefern, sondern auch umgekehrt.
In unserem Corona Blog schildern Studienleiter*innen der Akademie und der Akademie als Referent*innen verbundene Persönlichkeiten ihre Wahrnehmungen zur Coronakrise. Aus den verschiedenen interdisziplinären Arbeitsbereichen entsteht damit eine multiperspektivische Sicht, die in der Krise Orientierung bieten kann. Gleichzeitig wird deutlich, wie die Akademie ihre Arbeit auf diese Ausnahmesituation anpasst.




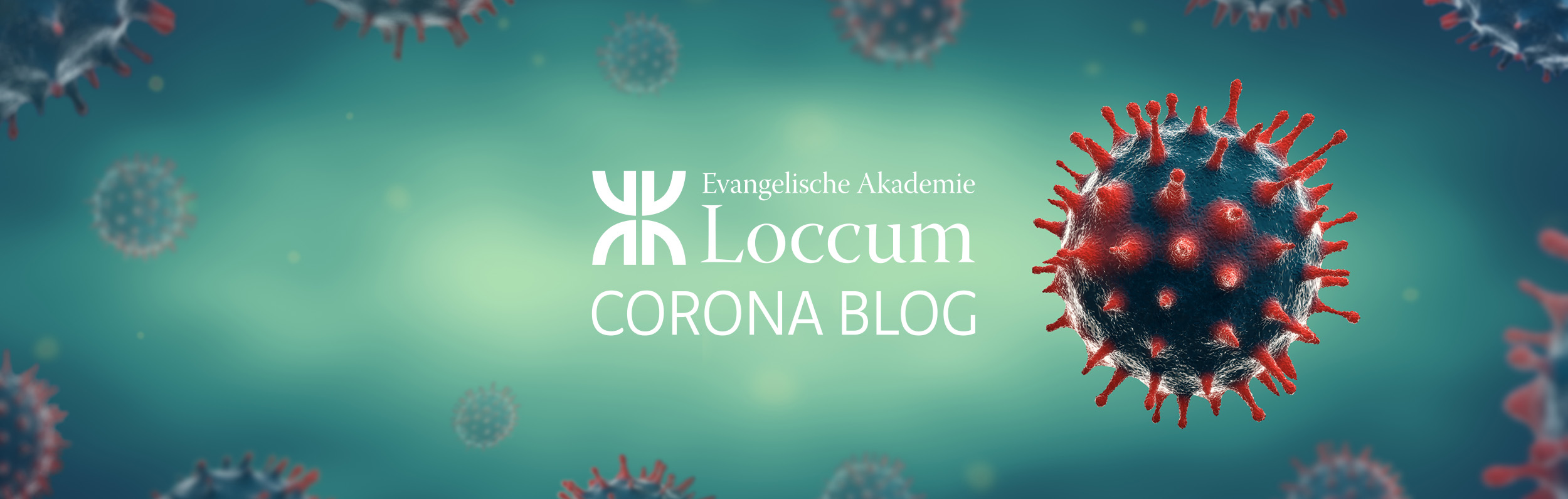




Neueste Kommentare